Globale Herausforderungen
Bei der Globalisierung handelt es sich um eine zunehmende weltweite Verknüpfung in den Bereichen Wirtschaft, Politik, Kommunikation und Kultur. Hierdurch sind neue globale Herausforderungen wie der Umgang mit dem Klimawandel, die Welternährung und internationale Gesundheit aufgekommen.
Inhaltsverzeichnis zum Thema
Was ist Globalisierung?
Vielleicht hast du schon einmal die Aussage gehört, die Menschen würden heutzutage in einer globalisierten Welt leben. Darunter kannst du dir zum Beispiel vorstellen, dass die Welt aufgrund von fortschreitender Technik, neuen Arbeitsplätzen und -möglichkeiten, globalem Handel oder gemeinsamen Interessen immer näher zusammenrückt. Auf diese Weise wird ein internationaler Austausch ermöglicht, der noch vor wenigen Jahrzehnten in diesem Ausmaß nicht möglich war. Hierdurch sind allerdings auch eine Vielzahl neuer Fragen und Herausforderungen aufgekommen, denen sich die Weltbevölkerung stellen muss. Zu diesen Problemen gehören zum Beispiel der Klimawandel, die Welternährung oder die Gesundheit. Diese Chancen und auch Schwierigkeiten sind allesamt Themen der Globalisierung.
Unter dem Begriff Globalisierung kannst du dir eine zunehmende Vernetzung der ganzen Welt vorstellen. Neben dem internationalen Handel, also der Wirtschaft, sind vor allem Politik, Kommunikation und die Verbreitung von Kulturen über Ländergrenzen hinweg einige der größten Themenbereiche. Sinnvolle Politik funktioniert dementsprechend in vielen Fällen nur noch über Staatenbündnisse. Als Beispiel hierfür kannst du dir als größten gemeinsamen Wirtschaftsraum der Erde die EU – Europäische Union vorstellen, in der feste Regelungen und Gesetze zum Umgang ihrer Mitgliedsstaaten existieren.
Einer der Gründe, warum der weltweite Austausch von Informationen in der heutigen Zeit so schnell erfolgen kann, ist die weitläufige Verbreitung von Massenmedien. Hierzu zählen das Fernsehen, das Telefon, das Radio und vor allem natürlich das Internet, das den sofortigen Zugriff auf aktuelle Ereignisse ermöglicht – unabhängig davon, wo sich der Nutzer auf der Welt befindet. Der weltweite Handel in seinem derzeitigen Ausmaß wird vor allem durch niedrige Treibstoffpreise in der Seefracht und Luftfracht ermöglicht. Stell dir mal vor, dass bei der Lieferung einer Tonne Kaffee aus Asien die Transportkosten nur ein Prozent des Preises ausmachen! Darüber hinaus wird politisch die Öffnung der Märkte reguliert. In vielen Bereichen wurden zum Beispiel Hindernisse wie Einfuhrzölle, -quoten oder -verbote umgangen.
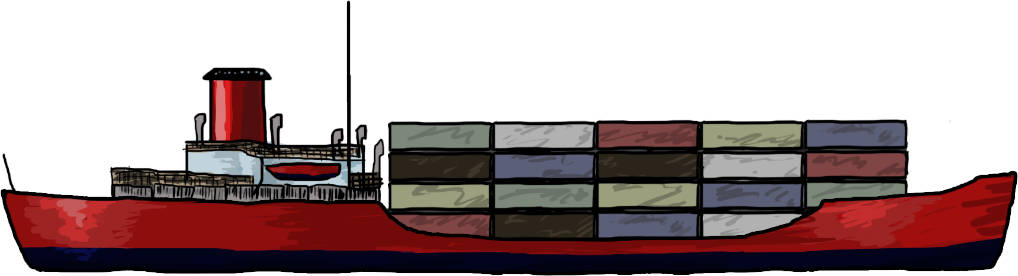
Globale Herausforderungen und Probleme
Die weltweite Verknüpfung und die Öffnung der Märkte bringen allerdings auch einige Nachteile mit sich. Viele Unternehmen streben einen multinationalen Ausbau an, um sich einerseits neue Märkte zu erschließen, andererseits jedoch auch, um billigere Produktionsstandorte in Ländern mit niedrigeren Löhnen aufzubauen. So investieren viele Firmen in ehemalige Schwellenländer wie China, Taiwan oder Indien, um dort Produkte zu geringstmöglichen Kosten zu erzeugen. Diese Produkte erzielen dann aufgrund ihres geringen Preises globale Erfolge. Durch das extreme Wirtschaftswachstum konnten zwar beispielsweise 500 Millionen Chinesen aus extremer Armut entkommen, doch viele Länder leiden auch unter den Folgen des internationalen Wettbewerbs. In den meisten südafrikanischen Ländern überschwemmen die billigen Produkte aus den Industrie- und Schwellenländern den Markt, führen zur Zerstörung örtlicher Produktionen und fördern somit wirtschaftliche Misserfolge und Armut. Besonders einige südafrikanische Länder leiden aufgrund der Wirtschaftslage unter extremem Hunger und erheblichen Problemen im Bereich der Gesundheit. Die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt hier bei Frauen lediglich 48, bei Männern 50 Jahre.
Im Bereich der Kultur wird von den negativen Seiten der Globalisierung auch oftmals von der McDonaldisierung gesprochen. Hierunter kannst du dir vorstellen, dass sich vor allem westliche Kultur und Populärkultur in Form von Filmen, Musik, Nachrichten, Produkten und der englischen Sprache durchsetzt und somit die kulturelle Vielfalt der eigenen Länder eingeschränkt wird. Teilweise ist aber auch zu bemerken, dass eine weltweite, verstärkte Rückbesinnung auf lokale und regionale Kulturen stattfindet.
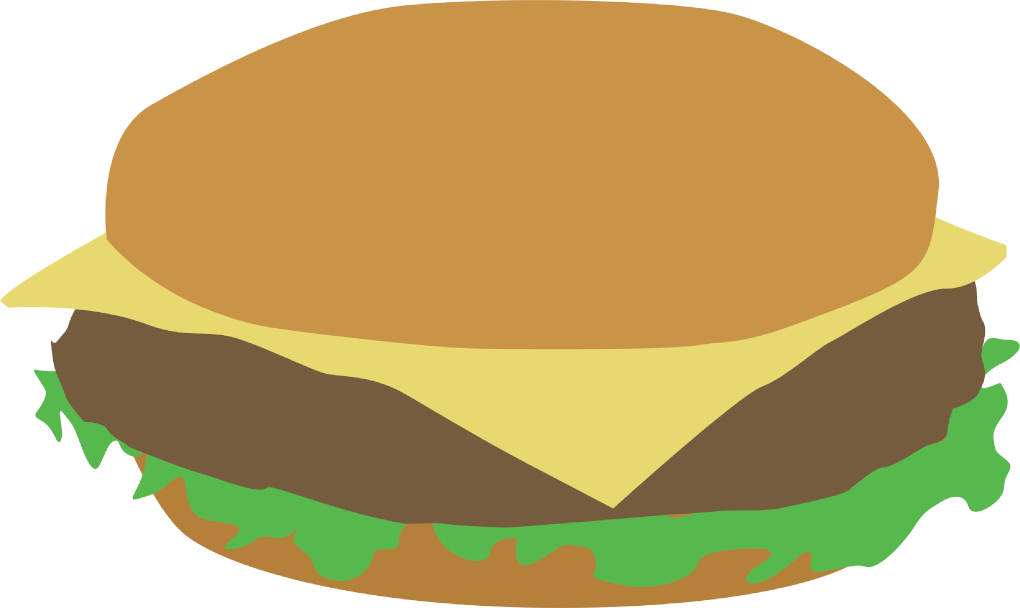
Weitere entscheidende Herausforderungen der Globalisierung finden sich in der Politik. Viele Themenbereiche wie der Klimawandel, Finanzkrisen oder der Terrorismus stoppen nicht an Ländergrenzen, sondern können nur gemeinsam angegangen werden. Aus diesem Grund existieren Staatenbündnisse wie die EU oder die UN – Vereinten Nationen, die gemeinsame Entscheidungen treffen. Hierbei kannst du dir allerdings auch den Nachteil für einige Länder vor Augen führen: Durch globale Themen und Akteure wird der politische Handlungsspielraum kleiner Staaten oftmals extrem eingeschränkt. Somit bleibt also festzuhalten, dass die Globalisierung zwar gute, aber ebenso schlechte Seiten hat. Während einige Staaten von ihr deutlich profitieren, existieren auch zahlreiche Länder, in denen sie die Probleme noch weiter verschärft hat.
Alle Lerntexte zum Thema
Lerntexte zum Thema
Globale Herausforderungen (2 Lerntexte)
Beliebteste Themen in Geschichte
- Alexander der Große
- Marie Antoinette
- Ermächtigungsgesetz
- Karl Der Große
- George Washington
- Katharina Die Große
- Französische Revolution
- Versailler Vertrag
- Stalin
- Hitler Geburtstag
- Wallenstein
- Martin Luther
- Vormärz
- Warschauer Pakt
- Paul Von Hindenburg
- Elizabeth Bowes-Lyon
- Weimarer Verfassung
- Watergate-Affäre
- Wiener Kongress
- Absolutismus
- Wer war Konrad Adenauer
- Vietnamkrieg
- Frauen In Der Französischen Revolution
- Gewaltenteilung
- Dolchstoßlegende
- Industrielle Revolution
- Deutscher Bund
- Ende 2. Weltkrieg
- Gründung Brd
- Gaius Julius Caesar
- Josef Stalin
- Oktoberrevolution
- Martin Luther King
- Mittelalterliche Stadt
- Queen Victoria
- Imperialismus
- Schwarzer Freitag
- Soziale Frage
- Was bedeutet Gleichschaltung
- Dante Alighieri
- Wannseekonferenz
- Verfassung 1871 Vorteile Nachteile
- Kapp-Putsch
- Erfindungen Industrialisierung
- Wollt Ihr Den Totalen Krieg
- Reichstagsbrand
- Hindenburg Zeppelin
- Nationalsozialismus
- NS Ideologie
- Puritaner














