Sprachgeschichte und Sprachwandel
Periode des Althochdeutschen, Mittelhochdeutschen, Frühneuhochdeutschen, Neuhochdeutschen als Perioden der Sprachentwicklung - die deutsche Hochsprache
Jetzt mit Spaß die Noten verbessern
und sofort Zugriff auf alle Inhalte erhalten!
30 Tage kostenlos testenInhaltsverzeichnis zum Thema
- Sprache als wandelbares System
- Erste und Zweite Lautverschiebung
- Die Sprachstufen des Deutschen
- Die Veränderung des Wortschatzes
Sprache als wandelbares System
Sprache ist immer im Wandel und reagiert damit unter anderem auf Veränderungen in der Lebenswelt der Sprecher: Während dir das Verb downloaden völlig vertraut vorkommt, hätten deine Großeltern in ihrer Jugend nichts mit diesem Wort anfangen können. Dass Wörter aus anderen Sprachen entlehnt und in die deutsche Sprache aufgenommen werden, passiert im Zuge des sogenannten Sprachwandels. Unter Sprachwandel versteht man den Prozess der Veränderung von Sprache im zeitlichen Verlauf. Der Sprachwandel betrifft dabei alle Ebenen eines Sprachsystems: die lautliche Ebene, die Schreibung, Flexion und Wortbildung, Satzstellung und Satzbau, die Bedeutungsebene und auch den Wortschatz einer Sprache.
Erste und Zweite Lautverschiebung
Die deutsche Sprache kann auf das Indoeuropäische zurückgeführt werden, das als eine gemeinsame Vorstufe der keltischen, romanischen germanischen, slawischen und baltischen Sprachen sowie des Griechischen, Albanischen, Persischen und des Altindischen rekonstruiert wurde. Im ersten Jahrtausend v. Chr. gab es einen Sprachwandelprozess, der als Erste Lautverschiebung (oder Germanische Lautverschiebung) bezeichnet wird. Hierbei kam es zu einer Veränderung in der Aussprache bestimmter Konsonanten und die germanische Sprachfamilie bildete sich aus. Zu dieser Gruppe verwandter Sprachen zählt das Deutsche als eine westgermanische Sprache, ebenso wie beispielsweise Englisch und Niederländisch. Diese Verwandtschaft der Sprachen erklärt auch deren Ähnlichkeit zueinander. Im Zeitraum vom 4. bis zum 6. Jahrhundert n. Chr. entwickelte sich im Zuge eines weiteren Sprachwandelprozesses - der Zweiten Lautverschiebung (bzw. Althochdeutschen Lautverschiebung) - aus dem Germanischen das Althochdeutsche. Die Veränderung der Aussprache verschiedener Konsonanten führte unter anderem dazu, dass sich die deutsche Sprache anders als das Englische entwickelte.
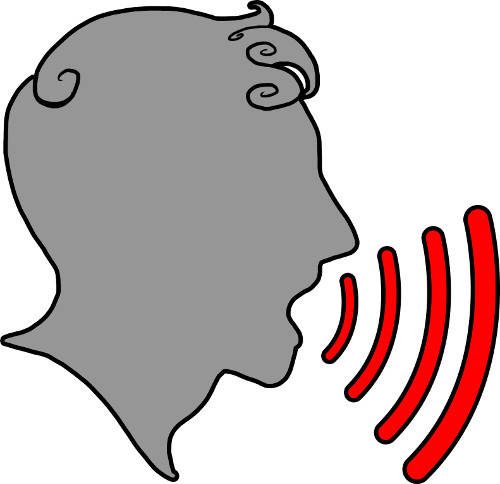
Die wichtigste Veränderung betraf dabei die Konsonanten p, t und k. Die Gegenüberstellung mit Wörtern aus dem Englischen hilft dir dabei, die Veränderungen besser nachvollziehen zu können:
- englisch apple im Vergleich zu Apfel (p wird zu pf oder f/ff)
- englisch (to) help im Vergleich zu helfen (p wird zu pf oder f/ff)
- englisch time im Vergleich zu Zeit (t wird zu s oder z)
- englisch (to) make im Vergleich zu machen (k wird zu ch)
Die Zweite Lautverschiebung fand jedoch nicht im gesamten deutschen Sprachraum gleichermaßen statt. Während der süddeutsche Sprachraum die Lautverschiebung in unterschiedlicher Ausprägung mitmachte, blieb im Norden Deutschlands der alte Sprachstand erhalten. Im Kontext der Zweiten Lautverschiebung bildeten sich somit verschiedene deutsche Dialekte aus, die bis heute in der gesprochenen Sprache vorhanden sind. Die Dialekte im hochdeutschen Sprachraum bilden die Grundlage für unsere heutige normierte Sprache und entwickelten sich im 16. Jahrhundert zur Standardsprache im deutschen Raum.
Die Sprachstufen des Deutschen
Das Althochdeutsche gilt als die älteste Sprachstufe des Deutschen und wird von circa 700 n. Chr. mit dem Einsetzen der schriftlichen Überlieferung bis 1050 n. Chr. datiert. Die Einteilung von Sprachstufen erfolgt anhand gemeinsamer Merkmalen und Besonderheiten einer Sprache innerhalb eines bestimmten Zeitraums, andererseits sind für die Einteilung der Sprachstufen auch politische, geographische und kulturelle Aspekte im Leben der Sprechergemeinschaft entscheidend.
Die nächste Sprachstufe des Deutschen ist das Mittelhochdeutsche, das sich zeitlich von circa 1050 n. Chr. bis 1350 n. Chr. erstreckt. In dieser Zeit entwickelte sich an den mittelalterlichen Höfen ein neues kulturelles Selbstverständnis, das zur Hervorbringung von literarischen Textgattungen wie dem Minnesang und dem höfischen Roman führte.
An das Mittelhochdeutsche schließt das Frühneuhochdeutsche an, das bis circa 1650 n. Chr. datiert wird. Der Beginn des Frühneuhochdeutschen ist außersprachlich stark mit der Regierungszeit Karl IV. in Prag und den hiermit verbundenen kulturellen Neuerungen verknüpft. Nicht zuletzt ist Luthers Bibelübersetzung ins Frühneuhochdeutsche entscheidend für diese Sprachstufe und wirkte maßgeblich auf die spätere Ausprägung einer einheitlichen deutschen Sprache hin. Das Ende der frühneuhochdeutschen Sprachperiode wird häufig mit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges um 1648 n. Chr. in Verbindung gesetzt.
Das Neuhochdeutsche dauert als Sprachstufe von circa 1650 n. Chr. bis heute an, obwohl sich diese Sprachstufe in den fast 400 Jahren ihres Bestehens gewiss in vielen Punkten verändert hat, beispielsweise im Wortschatz.
Die Veränderung des Wortschatzes
Während es im Deutschen Erbwörter gibt, die bereits seit dem Germanischen ein Bestandteil unseres Wortschatzes sind, werden auch Wörter aus anderen Sprachen in das Deutsche übernommen. Das Wort downloaden beispielsweise wurde aus dem Englischen übernommen, hat sich aber bezüglich der Schreibung und auf der lautlichen Ebene nicht weiter an das Deutsche angepasst. Da downloaden die „fremdsprachigen“ Merkmale des Englischen beibehalten hat, kannst du es auf den ersten Blick als Fremdwort erkennen. Neben Fremdwörtern gibt es noch Lehnwörter, die zwar auch aus anderen Sprachen in den deutschen Wortschatz übernommen wurden, jedoch so stark an die deutsche Schreibweise und Lautung angepasst worden sind. So sieht man vielen Wörtern im Deutschen gar nicht mehr, dass sie ursprünglich einmal Fremdwörter waren.
Unglaublich, was die deutsche Sprache schon alles mitgemacht hat, oder? Und da sich unsere Sprache auch in Zukunft beständig verändern wird, darfst du gespannt sein, welche Veränderungen dir vielleicht in den nächsten Jahrzehnten auffallen werden.
Alle Videos und Lerntexte zum Thema
Videos und Lerntexte zum Thema
Sprachgeschichte und Sprachwandel (5 Videos, 6 Lerntexte)
Alle Arbeitsblätter zum Thema
Arbeitsblätter zum Thema
Sprachgeschichte und Sprachwandel (10 Arbeitsblätter)
-
 Erbwort, Lehnwort, Fremdwort
PDF anzeigen
Erbwort, Lehnwort, Fremdwort
PDF anzeigen -
 Sprachwandel – Einfluss neuer Medien
PDF anzeigen
Sprachwandel – Einfluss neuer Medien
PDF anzeigen -
 Sprachgeschichte und Sprachwandel – Überblick
PDF anzeigen
Sprachgeschichte und Sprachwandel – Überblick
PDF anzeigen -
 Tendenzen der Gegenwartssprache
PDF anzeigen
Tendenzen der Gegenwartssprache
PDF anzeigen -
 Die Geschichte der Wörter
PDF anzeigen
Die Geschichte der Wörter
PDF anzeigen -
 Die verschiedenen Alphabete
PDF anzeigen
Die verschiedenen Alphabete
PDF anzeigen -
 Zur Geschichte der Schrift
PDF anzeigen
Zur Geschichte der Schrift
PDF anzeigen -
 Die Periode des Althochdeutschen
PDF anzeigen
Die Periode des Althochdeutschen
PDF anzeigen -
 Die Periode des Mittelhochdeutschen
PDF anzeigen
Die Periode des Mittelhochdeutschen
PDF anzeigen -
 Die Periode des Neuhochdeutschen
PDF anzeigen
Die Periode des Neuhochdeutschen
PDF anzeigen
Beliebteste Themen in Deutsch
- Präteritum
- Perfekt
- Präsens
- Artikel
- Subjekt
- Plusquamperfekt
- Umlaute
- Satzbau Deutsch
- Bestimmte Und Unbestimmte Artikel
- Satzzeichen – Übungen
- Buchvorstellung Planen
- Pronomen Grundschule
- Selbstlaute, Doppellaute Und Umlaute Erkennen
- Was Ist Ein Subjekt
- Possessivpronomen
- Anapher
- Gedichtanalyse
- Gedichtinterpretation Schluss
- Prädikat
- Woyzeck Zusammenfassung
- Konjunktiv I
- Denotation, Konnotation
- Wortarten
- Metapher
- heute Morgen
- Desweiteren oder des Weiteren
- als oder wie
- Komma vor oder
- Sowohl als auch - Komma
- Zu guter letzt
- Seit oder seid
- sodass oder so dass
- Bilderrätsel
- Komma vor aber
- Zu hause oder zuhause
- am besten groß oder klein
- bis auf weiteres
- einzige oder einzigste
- Komma vor wie
- Komma vor und
- morgens
- nochmal oder noch mal
- Rhetorische Frage
- Komma vor als
- Theodor Fontane
- folgendes groß oder klein
- weder noch Komma
- morgen groß oder klein
- nach Doppelpunkt groß oder klein
- Komma vor um
























