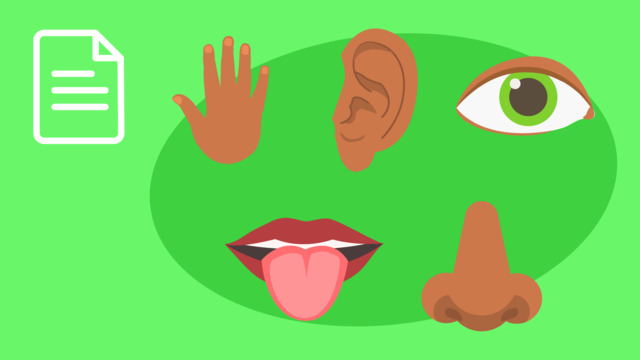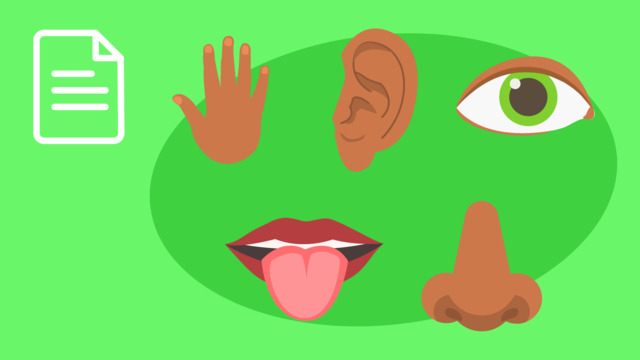Das Ohr – der Hörvorgang
Entdecke den Hörvorgang! Erfahre, wie das Gehör funktioniert und wie das Gehirn Schall verarbeitet. Mit einfachen Erklärungen und interaktiven Übungen vertiefst du dein Verständnis. Interessiert? Tauche ein und werde zum Experten für den Hörvorgang!
- Hörvorgang – Biologie
- Das menschliche Hören
- Hörsinn und Wahrnehmung – Definition
- Hörvorgang – Definition
in nur 12 Minuten? Du willst ganz einfach ein neues
Thema lernen in nur 12 Minuten?
-
 5 Minuten verstehen
5 Minuten verstehen
Unsere Videos erklären Ihrem Kind Themen anschaulich und verständlich.
92%der Schüler*innen hilft sofatutor beim selbstständigen Lernen. -
 5 Minuten üben
5 Minuten üben
Mit Übungen und Lernspielen festigt Ihr Kind das neue Wissen spielerisch.
93%der Schüler*innen haben ihre Noten in mindestens einem Fach verbessert. -
 2 Minuten Fragen stellen
2 Minuten Fragen stellen
Hat Ihr Kind Fragen, kann es diese im Chat oder in der Fragenbox stellen.
94%der Schüler*innen hilft sofatutor beim Verstehen von Unterrichtsinhalten.

Lerntext zum Thema Das Ohr – der Hörvorgang
Hörvorgang – Biologie
In unserer Umwelt ist immer etwas los. Wenn du für einen Moment leise bist, kannst du bestimmt viele Dinge hören – vielleicht spricht jemand oder du hörst das Video zum Thema Hören. Aber was passiert da eigentlich und wie funktioniert unser Gehör?
In dem Video Ohr – Aufbau und Funktion hast du bereits viel über den Aufbau und die Funktion des Ohrs gelernt. In diesem Text möchten wir genauer auf die folgenden Fragen eingehen:
- Was macht der Hörsinn?
- Warum ist der Hörsinn wichtig?
- Wie funktioniert unser Hörsinn?
- Was ist der Hörvorgang?
- Wie funktioniert der Hörvorgang überhaupt?
Das menschliche Hören
Wie du merkst, müssen zuerst die Begriffe Hörsinn und Hörvorgang voneinander unterschieden werden.
Hörsinn und Wahrnehmung – Definition
Beim Hörsinn handelt es sich um einen unserer fünf Sinne – Sehen, Hören, Schmecken, Riechen und Fühlen (Sinne und Sinnesorgane). Geräusche, Töne und Gespräche – bei all diesen Dingen handelt es sich um Reize, die du über den Hörsinn wahrnehmen kannst. Biologisch erklärt ist der Hörsinn also die Fähigkeit, Geräusche bzw. Schall wahrzunehmen. Der Hörsinn hat damit eine sehr wichtige Funktion in unserem Körper.
Hörvorgang – Definition
Der Hörvorgang hingegen beschreibt alle biologischen Prozesse, die im Körper ablaufen, um diese Reize aufzunehmen, im Ohr zu verarbeiten und an das Gehirn weiterzuleiten. Kurz zusammengefasst gelangen beim Hörvorgang Schallwellen zum Ohr und von dort werden über den Hörnerv Erregungen zum Gehirn geleitet, sodass wir am Ende etwas hören. All diese Prozesse werden wir dir im folgenden Text genauer erklären.
Hörvorgang im Innenohr – Ablauf
Der Hörvorgang in deinem Körper läuft immer nach dem gleichen Schema ab. Alle Reize, die wir hören können, bestehen aus Schallwellen. Diese Schallwellen werden von unserer Ohrmuschel aufgefangen und über den Gehörgang bis zum Trommelfell geleitet. Das Trommelfell wird von den Schallwellen in Schwingung versetzt. Diese Schwingungen werden auf die Gehörknöchelchen (Hammer, Amboss und Steigbügel) und von dort auf das ovale Fenster übertragen.
Das ovale Fenster ist eine Membran und der Eingang zum Innenohr. Weil es so viel kleiner ist als das Trommelfell, kommt am ovalen Fenster ein viel höherer Druck an, so ähnlich wie bei einem Verstärker. Im Innenohr findet nun der eigentliche Hörvorgang statt.
Beim Eintreffen der Schallwellen auf die Membran des ovalen Fensters werden die verstärkten Schwingungen auf die Lymphflüssigkeit im Inneren der Gehörschnecke übertragen. Von außen betrachtet handelt es sich bei der Gehörschnecke um einen langen, mit Flüssigkeit gefüllten Schlauch, der um sich selbst aufgerollt ist. Seine breiteste Stelle befindet sich dabei am ovalen Fenster und er ist immer schmaler zulaufend bis zu seiner schmalsten Stelle, die sich am runden Fenster befindet.
Das Innere des Schlauchs ist außerdem durch eine membranartige Wand in drei Gänge unterteilt. Der mittlere Gang ist der Schneckengang, darüber befindet sich der Vorhofgang und darunter der Paukengang. Der Vorhofgang beginnt am ovalen Fenster und der Paukengang endet am runden Fenster, verbunden sind die beiden Gänge in der Mitte durch das Schneckentor.
Im Schneckengang befinden sich die circa 16 000 Hörsinneszellen. Wird die Lymphflüssigkeit innerhalb der Gehörschnecke in Schwingung versetzt, dann verbreiten sich die Schwingungen zunächst durch den Vorhofgang, werden anschließend über das Schneckentor auf den Paukengang übertragen und breiten sich dort weiter bis zum runden Fenster aus. Das runde Fenster dient dem Druckausgleich, wobei der Druck an die Paukenhöhle und die Ohrtrompete übertragen wird.
Schwingen die beiden Gänge der Gehörschnecke, so schwingen auch die Membranhäute mit den Hörsinneszellen innerhalb der Schnecke. Die Hörsinneszellen liegen auf der Grundmembran und über ihnen liegt eine dünne Deckmembran, die beide durch die Schallwellen in Schwingungen versetzt werden. Die Hörsinneszellen besitzen auf ihrer Oberfläche kleine Härchen, die mit der Deckmembran verbunden sind. Daher werden diese Hörsinneszellen auch als Haarzellen bezeichnet. Bei der Bewegung der Deckmembran geraten auch die Härchen der Haarzellen in Bewegung. Man spricht von einem mechanischen Reiz an den Haarzellen. Dieser löst eine elektrische Erregung der Haarzellen aus, die über die angrenzenden ableitenden Nervenfasern über den Hörnerv an die seitlichen Hörfelder der Großhirnrinde weitergeleitet wird.
Im Gehirn findet dann die Tonwahrnehmung, also der eigentliche Höreindruck, statt. Damit kannst du auch mit geschlossenen Augen genau orten, aus welcher Richtung die Schallquelle im Raum kommt. Diese Fähigkeit bezeichnet man als räumliches Hören.
Räumliches Hören
Wie das Gehirn durch seine Verrechnungen räumliches Hören möglich macht, erklären wir dir an einem alltäglichen Beispiel. Stell dir dafür einmal vor, dass du in einem Schwimmbecken stehst. Die Schallwellen breiten sich dabei aus wie Wellen auf dem Wasser, wenn ein Gegenstand ins Wasser fällt. Wirft jemand nun also einen Gegenstand genau vor dir oder genau hinter dir ins Wasser, dann kannst du dir vorstellen, dass die Wellen im Wasser gleichzeitig an deinen linken und deinen rechten Arm prallen. Genauso nehmen deine beiden Ohren Geräusche, die genau vor oder hinter dir entstehen, gleichzeitig wahr.
Wird der Gegenstand nun rechts von dir ins Wasser geworfen, dann werden die Wellen an deinem rechten Arm zuerst antreffen. Wird er links von dir ins Wasser geworfen, dann treffen die Wellen zuerst auf deinen linken Arm. Dadurch kannst du auch mit geschlossenen Augen spüren, an welcher Stelle der Gegenstand ins Wasser geworfen wurde.
Genauso, wie die Zellen in deiner Haut die Welle auf deinem Arm registrieren, registrieren die Haarzellen im Ohr das Eintreffen von Schallwellen im rechten und im linken Ohr. Das bedeutet, dass die zeitliche Verrechnung zwischen Eintreffen des Schalls im rechten und im linken Ohr eine Lokalisation der Schallquelle im Raum ermöglicht.
Das Gehirn verrechnet die Zeitunterschiede, also wie viel früher die Schallwellen an einem Ohr angekommen sind als an dem anderen Ohr. Dabei ist die Verrechnung aber viel genauer als bei Wellen auf dem Wasser. Zeitunterschiede von bis zu 0,03 Millisekunden können durch dein Gehirn zu einer exakten Bestimmung der Richtung verrechnet werden.
Das Ohr und der Hörvorgang – Zusammenfassung
In diesem Text hast du gelernt, was der Hörsinn und der Hörvorgang sind und wie du sie unterscheiden kannst. Wir haben dir den Hörvorgang einfach erklärt und du hast gelernt, wie das Gehirn räumliches Hören ermöglicht.
9.918
sofaheld-Level
6.600
vorgefertigte
Vokabeln
7.800
Lernvideos
37.172
Übungen
32.630
Arbeitsblätter
24h
Hilfe von Lehrkräften

Inhalte für alle Fächer und Schulstufen.
Von Expert*innen erstellt und angepasst an die Lehrpläne der Bundesländer.
Testphase jederzeit online beenden
Beliebteste Themen in Biologie
- Was ist DNA
- Organe Mensch
- Meiose
- Pflanzenzelle
- Blüte Aufbau
- Feldmaus
- Chloroplasten
- Chlorophyll
- Rna
- Chromosomen
- Rudimentäre Organe
- Wirbeltiere Merkmale
- Mitose
- Seehund
- Modifikation
- Bäume Bestimmen
- Metamorphose
- Synapse
- Synapse Aufbau und Funktion
- Ökosystem
- Amöbe
- Blobfisch
- Phänotyp
- Endoplasmatisches Retikulum
- Karyogramm
- RGT Regel
- Biotop
- Eukaryoten
- Zellmembran
- Calvin-Zyklus
- Codesonne
- Fotosynthese
- Allel
- Ribosomen
- Golgi-Apparat
- Nukleotid
- Mitochondrien
- Genotyp
- Zellorganellen
- Phospholipide
- Vakuole
- Gliazellen
- Nahrungskette Und Nahrungsnetz
- Phagozytose
- Vesikel
- Biozönose
- tRNA
- Kompartimentierung
- Sympatrische Artbildung
- Transpiration


 5 Minuten verstehen
5 Minuten verstehen
 5 Minuten üben
5 Minuten üben
 2 Minuten Fragen stellen
2 Minuten Fragen stellen

 Bereit für eine echte Prüfung?
Bereit für eine echte Prüfung?